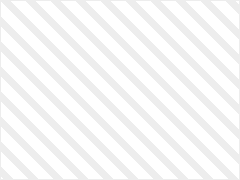Im Zusammenhang mit einem Aufstand in Tibet, über dessen Natur man hierzulande wenig weiß, aber viel vermutet, der Reaktion der chinesischen Regierung auf diesen Aufstand, der tendenziösen und manipulativen Berichterstattung westlichen Medien über den Aufstand und die chinesischen Reaktionen auf den Aufstand, und der hysterischen und albern-verschwörungstheoretischen Reaktion chinesischen Medien auf die tendenziöse und manipulative Berichterstattung westlichen Medien ist auch vom offensichtlich bedeutungsschwangeren "olympischen Feuer" und dessen Schutz die Rede.
Wenn man sich die Ursprünge des "olympischen Feuers" ansieht, dann steht es schwerlich für das, was heute zum "olympischen Gedanken" erklärt wird (als da wären: fairer Wettstreit, Völkerverständigung, Frieden, Freiheit, Gleichberechtigung, usw. usw. usw. - nicht zu vergessen die großen olympischen Geisterbeschwörungen: der Beschwörung des Geistes von Baron Pierre de Coubertin und die Beschwörung des Geistes der Antike).
Mit dem Baron de Coubertin hat die Flamme und der Fackellauf nichts zu tun, denn erst 1928 wurde erstmals eine "olympische Flamme" entzündet. Das heute übliche Feuerritual - mit feierlicher Entzündung im Hain von Olympia, Fakelläuferstaffette, feierlicher Entzündung des Feuers, Bewahrung der "Reinheit der Flamme" usw. - wurde zur Nazi-Olympiade von 1936 eingeführt - wobei es letzten Endes egal ist, ob die Idee aus dem Propagandaministerium kam oder doch vom nazi-hörigen Sportfunktionär Carl Diem, dem Organisator der olympischen Spiele.
Was die Antike angeht: man könnte, mit viel Mühe und einige Verdrehungen, im heilige Feuer der Hestia und in den Fackelumzügen im alten Athen, "historische Vorbilder" für den neuzeitlichen Feuerkult konstruieren. Denn etwas, was auch nur annähernd dem Nazi-Fackellaufspektakel entspräche, gab es im antiken Griechenland nicht.
Der olympische Fackellauf steht im Fokus antichinesischer Demonstranten. Aber schon seitdem die Nazis die Propaganda-Veranstaltung 1936 einführten, wird gegen das Ritual der "scheinheilgen Flamme" demonstriert.
Wikipedia:
Olympische Flamme
Zeit-online:
Fragen zum Fackellauf
einestages.spiegel.de:
Wenn die Flamme nicht lang fackelt
heise-tp:
"Löscht die Flamme".
Nun mag sich mancher meiner Leser die Frage stellen, wieso ich mich über so ein Symbol, mag es auch von den Nazis erfunden sein, aufregen würde. Ich würde ja schließlich auch nicht die Autobahnen boykottieren oder auf die Verlegung der gewerkschaftlichen 1.Mai-Kundgebungen auf einen anderen Termin bestehen (weil der 1. Mai unter den Nazis Feiertag wurde).
Der Grund liegt daran, dass die Symbolik seitens der Nazi-Propaganda sehr sorgfältig ausgewählt und ebenso sorgfältig inszeniert wurde. Ein "Symbol" ist immer mehr als ein simples Zeichen - es steht für etwas, es bewirkt etwas.
Für die Fachleute unter meinen Lesern: ich beziehe mich auf den Symbolbegriff von
Ernst Cassierer (Der Mensch hat nur über Symbole einen Wirklichkeitsbezug), den von Goethe (Symbol auf als "aufschließende Kraft“, die im Besonderen das Allgemeine (und im Allgemeinen das Besondere) darzustellen vermag) und
Joseph Campbell (Verweis des Symbols auf die Transzendenz.) Ich gebe zu, dass es schwierig ist, diese drei Auffassungen zusammenzudenken. Sie sind eher komplementär als kompatibel.
Der Mythos des Olympischen Feuers ist insofern echt, als das er wirkt, mag er ursprünglich ein eher banales, ahistorisches und "zusammengeklautes" Propagandakonstrukt sein.
Einen Eindruck von dem "Programm", das hinter der Fackellaufsymbolik steht, gibt die Anfangsszene eines (leider) hervorragend gemachten und (noch mehr leider) auch für mich ästhetisch reizvollen Films: Leni Riefenstahls Olympia-Film "Fest der Völker".
Die Kamera fährt durch eine in Dunst gehüllte Landschaft, in der die Überreste antiker Tempel, oft nur überwachsene Mauerreste und zertrümmerte Säulen, zu sehen sind. In einer für damalige Verhältnisse erstaunlich fließenden Fahrt nähert sich die Kamera einem besser erhaltenen Tempel inmitten der antiken Steine, umkreist ihn. Die Köpfe und Körper griechischer Statuen erscheinen in der Landschaft, von der Kamera Riefenstahls geradezu sinnlich umkurvt und umschmeichelt. Durch Überblendung "erwacht" ein nackter Diskuswerfer "zum Leben", auch andere marmorne Athletenstatuen werden "lebendig". Schließlich "erwacht" eine Statue eines Speerwerfers. Der Speer zielt auf eine Feuerschale. Ein (beinahe) nackter Athlet entzündet die olympische Fackel, hebt sie triumphierend empor.
(Der Wirkung tut es keinen Abbruch, wenn man weiß, dass (einige der) "antiken Ruinen" aus Pappmaché bestanden, weil die Aufnahmen aus dem antiken Olympia nicht für die Inszenierung zu gebrauchen waren, und dass die (fast) nackten Modellathleten nicht im heißen Sand von Olympia, sondern am zur Zeit der Aufnahme recht kühlen Strand der Ostsee agierten.)
Überblendung zum "realen Geschehen": der Fackellauf beginnt. Es wird gezeigt, wie die Flamme von einem Träger zum nächsten weitergegeben wird, bis zum im Film noch gewaltiger als in der Realität wirkenden Berliner Olympia-Stadion. Hier entzündet der letzte Läufer der Stafette die Olympische Flamme, einen einem antiken Altar nachempfundenen Gasbrenner. Die Kamera verharrt auf der Sonne, vibrierend in der heißen Luft über der Flamme. Die Menschenmassen jubeln, Hitler grüßt die Flamme.
Der erste Eindruck: "Ganz großes Kino", in doppelter Bedeutung. Dieser imposante Eindruck, sowohl des Fackellaufes wie seiner filmischen Inszenierung, wird auch der Grund dafür gewesen sein, dass das IOC nach 1945 so unkritisch an der Nazi-Symbolik festhielt - sie ist einfach eine zu "gute" Show; so, wie bisher alle olympischen Spiele mehr oder weniger deutlich die Nazi-Olympiade von 1936 imitierten.
Was zeigt die Filmsequenz, symbolisch betrachtet? Sie zeigt, unter anderem, wie die Fackel vom antiken Griechenland an Nazi-Deutschland weitergegeben wird. Das "3. Reich" beansprucht das Erbe der Antike. Der Anspruch ist, wie viele Ansprüche der Nazis, so hohl und papiern wie die Säulen in Leni Riefenstahls Studiodekoration; er funktioniert nach dem Prinzip: "Frechheit siegt!" Wird er nur laut genug verkündet und oft genug wiederholt, wird "die breite Masse" diese Behauptung schlucken. So, wie sie geschluckt hat, dass die Nazis die "rechtmäßigen Erben" der alten Germanen seien, oder die, dass "Arier" grundsätzlich allen anderen "Rassen" überlegen seien - oder den, dass sich der Vernichtungsantisemitismus "wissenschaftlich begründen" ließe. Das Schlimme ist, dass die meisten dieser "geschluckten" Behauptungen den Untergang der Nazireiches überlebten - manche bis heute.
Natürlich stellt das heutige IOC die Fackellauf-Symbolik anders dar - die Flamme würde die positiven Werte, die die Menschheit schon immer mit dem Feuer verbunden hätte, symbolisieren, oder dass die Fackelstafetten eine Botschaft des Friedens und der Freundschaft unter den Völkern aussenden.
Das Dumme ist nur, dass die olympischen Rituale immer noch die selbstverliebte, selbstherrliche und herrische "braune Aura" des Nazimythos umwabert. Man denke nur an die umständlichen Vorkehrungen, mit der die "Reinheit der Flamme" gesichert wird - wird sie (wie dieses Jahr mehrmals geschehen) gelöscht, muss sie mit z. B. in einer Grubenlampe "bewahrtem" Originalfeuer neu entzündet werden. Erlöschen alle "Backup-Flammen", dann muss gemäß dem Reglement die Flamme im heiligen Bezirk von Olympia neu entfacht werden.
Mir fällt dazu nur ein: ein religiöser Ritus. Und zwar einer, der mit der heidnischen Antike nichts gemeinsam hat - aber alles mit dem Mystizismus der Nazis (und ihrer Pedanterie).
Ich habe eine lange und ernsthafte Diskussion über die Frage geführt, ob z. B. Runen in der Öffentlichkeit verwendet werden dürfen. (Nicht juristisch gesehen, sondern moralisch.) Auch wenn ich dabei Anregungen der Art, man möge, im Zuge der "Null-Toleranz" und einer Politik der Nadelstiche, einige von Nazis und Neonazis verwendete Runen "verbieten", für abwegig (und nebenbei sinnlos) halte, so kann ich das Unbehagen etwa des Journalisten Thoralf Staud angesichts eines rechtsextremen Dachdeckers, der mit der "Lebensrune" in einem Schaukasten direkt vor dem Anklamer Gymnasium wirbt, ohne dass es jemanden stört, gut nachvollziehen. (Zeit online:
Glatzenbrot und Lebensrunen.) Das gilt unabhängig davon, dass die entsprechende Rune nicht von den Nazis erfunden, sondern "nur" missbraucht wurde, dass die Deutung dieser Rune (im älteren Futhark Algiz - Elch - genannt - sieht so aus wie das "Peace"-Zeichen, nur auf dem Kopf stehend und ohne Kreis) als Lebensrune (vorsichtig formuliert) umstritten ist, und dass nicht jeder, der diese oder andere Runen verwendet, rechtsextrem sein muss.
Das Fazit, das ich aus der Diskussion gezogen habe: die Runen können zwar nichts durch ihre Verwendung durch Nazis und es ist keine gute Idee, den inwändig Braunen diese Symbole einfach zu überlassen, aber es wäre eine noch schlechtere Idee, zu vergessen, dass Runen
auch "beliebte" Nazi-Symbole sind.
Die zur Zeit meist verwendete "echte" Rune ist übrigens eine "Binderune" aus Hagalas (in der Sternform des jüngeren Futhark, Lautwert "H") und "Berkano" (Lautwert) "B" - die Initialen Harald Blauzahns als Symbol für "Bluetooth". Eine locker-unbefangene Form der Runenverwendung, die dem düsteren Nazi-Mystizismus genau so entgegengesetzt ist, wie etwa die Ansuz-Berkano-Berkano-Ansuz Tätowierung, die ein Wikinger im Zeichentrickfilm "Asterix und die Wikinger" trägt.
Überträgt man diese Erfahrung auf den olympischen Fackellauf, der, anders als die Runen, wirklich eine Nazi-Erfindung ist, so verbietet sich die unkritische (!) Weiterverwendung dieser Symbolik eigentlich automatisch. Zumindest mit der "sakralen Aura" der Flamme, die wie gesagt eine "braune Aura" ist, müsste Schluss sein. Leider ist das IOC und sind die nationalen olympischen Komitees in dieser Hinsicht völlig unkritisch.
Eine ohne Brimborium mit dem Feuerzeug entzündete Flamme würde, wenn man schon ein feierliches Symbol für die Dauer der Spiele braucht, völlig ausreichen. Lockerheit ist ein gutes Gegenmittel gegen Nazi-Mystizismus. Ansätze zur heiteren Lässigkeit gab es schon bei einigen olympischen Spielen - leider immer nur Ansätze. Das starke Repräsentationsbedürfnis der Veranstalter lässt den Abschied von Inszenierungen frei nach "1936" offensichtlich nicht zu.
Soweit der allgemein-politische Teil meines Unbehagens gegenüber der olympischen Fackelstafette.
Es ist meine sprirituelle Ausrichtung, die dieses "politische" Unbehagen verstärkt. Es heißt, dass es den Urhebern eines Rituals "spirituelle Energie" zuführt, wenn dieses Ritual von anderen ausgeübt wird. Sicher, das klingt arg nach Esoterik-Messe. Wenn man aber "Energie" auch im übertragenen Wortsinn begreift, und überhaupt eine metaphysische Wirksamkeit von Ritualen - egal wie und auf welchem Wege - für möglich hält, dann wird schnell klar, weshalb es mir bei der "Wiederaufführung" eines Nazi-Rituals ziemlich flau im Magen wird.
Ein anderes "Ritual" - oder besser gesagt, die dem Nazi-Feuerzauber vorausgehende Inszenierung - verursacht bei mir kein flaues Gefühl im Magen, sondern einfach nur bitteres Lachen.
Auch die "Entzündungs-Zeremonie" der olympischen Flamme stammt offensichtlich aus dem Kino - allerdings nicht aus einem (leider) ästhetisch ansprechendem Propagandafilm, der durchaus zurecht zu den besten Sportfilmen aller Zeiten gerechnet wird, sondern aus einem billigen "Sandalenfilm" aus den 50er oder 60er Jahren, etwa vom Kaliber "Herkules und die Königin der Amazonen".
Kernelement sind Schauspielerinnen in weißen Gewändern, die edel-gemessen dahinschreitend eine Art Eurythmie-Vorführung im Freien aufführen, ganz so, wie sich der von jeder historischen Bildung unbeeinflusste "kleine Max" das klassische Griechenland vorstellt. ("Asterix bei den Olympischen Spielen" ist da erheblich authentischer.) Mit der Antike, dem spürbaren "Genius Loci" des alten heiligen Bezirkes, dem Geist und der Geschichte des antiken Olympias, hat diese alberne Zeremonie nichts zu tun. Mit dem (mutmaßlichen) Ablauf der einst in Olympia ausgeübten Rituale erst recht nichts.
Richtig "nett" wird es, wenn die "Priesterin" die alten Götter Griechenlands anruft: "Apollon, Gott der Sonne und des Lichtes, schicke deine Strahlen und entzünde die heilige Fackel für die gastfreundliche Stadt Peking. Und Du, oh Zeus, schenke Frieden allen Völkern der Erde und bekränze die Sieger des heiligen Wettkampfes." Irgendwie erinnert mich das an Ritualversuche pubertierender Mädchen, die ein ganz tolles Buch von, sagen wir mal, Hexe Sandra gelesen haben, und nun glauben, ganz doll magische Junghexen zu sein. Oder (Vorsicht Insiderwitz!) an Asatrú nach "Hägar dem Schrecklichen".
Zum Glück für die Veranstalter haben die alten Götter und die meisten ihren Anhänger Humor. Würde bei der "Flammenentzündung" z. B. eine katholische Messe in ähnlicher Weise verhackstückt, wäre das vermutlich das Ende des Fackelzaubers - wenn nicht der olympischen Spiele. Die Folgen eines entsprechenden pseudo-islamischen Ritual-Schmierentheaters für den Weltfrieden möchte ich mir gar nicht ausmalen ...