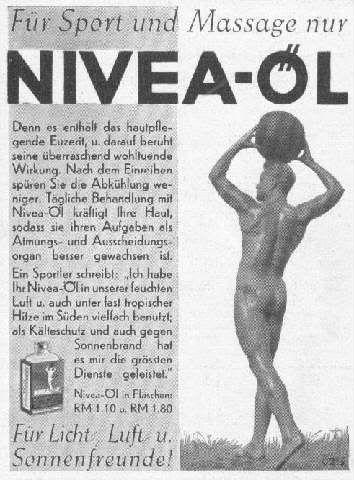Imperien
Eine stehendes kulturelles Klischee ist das des "bösen Imperiums".
Ein beinahe durchgehender Mythos, gerade in der Populärkultur von "Asterix" bis "Star Wars" (ich bin erklärter Fan von beidem)."Imperialismus" ist eines der schlimmsten Schimpfworte des politischen Sprachgebrauchs, und im Gegensatz zu "Faschistisch" auch von der politischen Extremrechten verwendbar, die es tatsächlich gerne und oft verwendet.
Ohne jeden Zweifel ist die Geschichte expansiver Vielvölkerstaaten blutig, grausam und unterdrückerisch. Kein Imperium hat eine moralisch saubere Weste.

Gaius Julius Ceasar Octavianus, genannte Augustus - ein ambivalenter Herrscher. (Foto: Pixelquelle)
Dennoch: Imperien haben eine weitaus bessere zivilisatorische Bilanz als Nationalstaaten. Es mag aus Position eines "Germanen", dessen Sympathien ganz klar bei Arminius, nicht bei Varus liegt (und noch klarer bei Widukind gegenüber Karl, dem "Großen" - siehe: Die Sachsenkriege ), seltsam klingen, aber ich halte in mancher Hinsicht das römische Reich für eines der seltenen Beispiele einer im positiven Sinne gelungenen Kolonisierung.
Zur Einläuterung eine Szene aus "Das Leben des Brian" -
die Volksfront von Judäa (V V J, nicht zu verwechseln mit der Judäaischen Volksfront) plant einen Anschlag auf die Besatzer:
Nein, ich rede nicht dem anderen alten Klischee, dem des "Zivilisationsbringers römisches Reich", das Wort. Den alten Hebräern mußten die Römer bestimmt keine zivilisatorische Errungenschaften bringen. Auch das, was Wilhelm Tacke neulich in der taz schrieb, ist schwerlich historisch haltbar:
Bonifatius - ein Europäer wo es unter anderem hießt:
Die Römer ware sicher nicht "besser" als die Barbarenvölker. Aber sie waren besser organisiert. Und sie waren erstaunlich tolerant und integrationsfähig. Als Rom 1000-jähriges Jubiliäum feierte, da saß der Sohn eines syrischen Scheichs auf dem Thron Philippus Arabs. Auch Arminus war römischer Offizier und römischer Bürger. In der "Varusschlacht" besiegte strenggenommen eine "römische" Armee eine andere römische Armee.
Und diese Integrationsfähigkeit, die Chance für jeden, römischer Bürger zu werden, die Fähigkeit, eine "multikulturelle", relativ offene, Gesellschaft zu bilden, machte die eigentliche Stärke des Imperiums aus. Als es unter Diocletian und Constantin (sehr zu unrecht "der Große" genannt) zu einem totalitären Obrigkeitsstaat umgemodelt wurde, wurde es scheinbar militärisch gestärkt, in Wirklichkeit aber seiner Stärken beraubt.
Die zivilisatorische Bilanz der meisten Imperien ist weniger gut als die des römischen Reiches, aber einige schneiden und schnitten auch wenn man Raubkriege und Ausbeutung berücksichtigt, erstaunlich gut ab, z. B. das "British Empire". Trotz Opiumkrieg und einiger Völkermorde.
Imperien gibt es in die Gegenwart: Russland hat eindeutig den Chrakter eines Imperiums, China mehr oder weniger auch, die USA eigentlich nicht - sie sind etwas weltgeschichtlich Neues. In mancher Hinsicht ist auch die EU ein "Imperium" - in anderer nicht, denn die Europäische Union ist polyzentrisch, sie hat im Unterschied zum klassischen Imperium mehrere "Führungsmächte".
Warum aber haben Imperien so einen schlechten Ruf, verglichen mit Nationalstaaten?
Wir haben uns daran gewöhnt, die Geschichte als evolutionären Prozeß vorzustellen, in dessen Verlauf der Nationalstaat das Imperium ablöst. Genau so, wie die Auflösung der großen Kolonialreiche in zahlreiche, willkürlich konstruierten "Nationalstaaten" mit höchst willkürlichen Grenzen als Fortschritt gesehen wurde.
Der Nationalstaat ist historisch recht jung, erste Nationalstaaten entwickelten sich im spätmittelalterlichen Europa, und zwar nicht "naturwüchsig", sondern indem sich ein Fürst und seine Gefolgschaft sich kraft seiner Hausmacht zunächst politisch und später kulturell gegen die Konkurrenz durchsetzte. Im "Heilligen Römischen Reich deutscher Nation" fehlte dieser Prozess fast völlig, es blieb ein locker zusammenhängernden Flickenteppich, weshalb der "verspäteten Nation" Deutschland stärker als anderen Nationen der "Konstruktcharakter" anzumerken ist: eine Nation, die buchstäblich gewaltsam zusammengeschmiedet wurde, und zu deren wichtigsten Klammer von Anfang an die Angst vor der (fast immer nur eingebildeten) äußeren Bedrohung gehörte.
Aber auch die Geschichte "besser konstruierter" Nationalstaaten ist mit wenigen Ausnahmen blutiger, brutaler, unterdrückerischer als die der großen Imperien. Intoleranz im Inneren und Aggression nach Außen sind die Hauptkennzeichen politischer Gebilde, die sich auf ethnischer "Homogenität" - gleiches "Blut", gleiche Kultur und vor allem gleiche Religion - gründen.
Wobei die "Homogenität" der Nationalstaaten stets Augenwischerei ist: kein Nationalstaat (wirklich keiner!) ohne "nationale Minderheiten". Weil sich fast alle Nationen auf eine Ideologie der "einheitlichen" oder zumindest "gemeinsamen" Sprache, Kultur, Religion und Geschichte, in besonders dummen Fälle auch auf "gemeinsames Blut" gründen, ist ein Nationalstaat tendenziell intolerant. Bis zum Völkermord. Das vielgepriesene "Selbstbestimmungsrecht der Völker" erwies sich oft, sehr oft, als Quelle von Unterdrückung, Vertreibungen, Grenzstreitigkeiten. Wobei das "Selbstbestimmungsrecht der Völker" ohnehin eine Fiktion ist - ein Volk ist ja kein Kollektivorganismus mit gemeinsamem Willen. Bestenfalls gibt es Mehrheitsentscheidungen innerhalb einer Bevölkerung.
Imperien haben eine bessere zivilisatorische Bilanz als Nationalstaaten. Die ideale Staatsform sind sie deshalb noch lange nicht. "Imperialismus" hat nicht zufällig einen schlechten Ruf. Neben den oben skizzierten "nationalistischen" Genoziden gibt es auch "imperialistische" Genozide. Und zwar immer dann, wenn die Einwohner eines zu erobernden Landes gleichgültig oder lästig waren.
Die Europäer brachten z. B. den Ureinwohnern Amerikas nicht "die Zivilisation" und waren auch nicht daran interessiert, sie als Bürger in ihre Kolonialimperien einzugliedern. Es ging schlicht um Land und Bodenschätze. Die Ureinwohner wurden in aller Regel nur als lästiger Störfaktor oder bestenfalls als Arbeitskräfte gesehen. Ähnlich lief die Kolonisation in den meisten Teilen Afrikas ab. (Ich vernachlässige hier absichtlich, dass die Kolonialimperien im Kern Nationalstaaten waren.)
Was ist also die zeitgemäße Staatform, in der sich Demokratie und pluralistische, offene Gesellschaft am besten entfalten können?
Es ist meiner Ansicht nach der postnationale Vielvölkerstaat. Ansatzweise sind die USA solch ein Staat, auch Indien könnte sich in diese Richtung entwickeln. Ich hoffe, dass die EU sich zu solch einem Staat weiterentwickelt. Aber am nähesten kommt diesem Ideal die Schweiz.
Diese Staatsform hat den Vorzug, dass kleine Volksgruppen in ihm keine geduldeten oder unterdrückten "nationalen Minderheiten" sind, sondern eben nur "kleine Volksgruppen".
Ein Spruch aus bioregionalistischen Kreisen ist: "Nur die Stämme werden überleben".
Ich setze dem entgegen: Stämme werden nur in postnationalen Vielvölkerstaaten überleben.
Ein beinahe durchgehender Mythos, gerade in der Populärkultur von "Asterix" bis "Star Wars" (ich bin erklärter Fan von beidem)."Imperialismus" ist eines der schlimmsten Schimpfworte des politischen Sprachgebrauchs, und im Gegensatz zu "Faschistisch" auch von der politischen Extremrechten verwendbar, die es tatsächlich gerne und oft verwendet.
Ohne jeden Zweifel ist die Geschichte expansiver Vielvölkerstaaten blutig, grausam und unterdrückerisch. Kein Imperium hat eine moralisch saubere Weste.

Gaius Julius Ceasar Octavianus, genannte Augustus - ein ambivalenter Herrscher. (Foto: Pixelquelle)
Dennoch: Imperien haben eine weitaus bessere zivilisatorische Bilanz als Nationalstaaten. Es mag aus Position eines "Germanen", dessen Sympathien ganz klar bei Arminius, nicht bei Varus liegt (und noch klarer bei Widukind gegenüber Karl, dem "Großen" - siehe: Die Sachsenkriege ), seltsam klingen, aber ich halte in mancher Hinsicht das römische Reich für eines der seltenen Beispiele einer im positiven Sinne gelungenen Kolonisierung.
Zur Einläuterung eine Szene aus "Das Leben des Brian" -
die Volksfront von Judäa (V V J, nicht zu verwechseln mit der Judäaischen Volksfront) plant einen Anschlag auf die Besatzer:
Reg: Was haben sie (die Römer) je als Gegenleistung erbracht, frage ich.Eine treffende Karrikatur des "Befreiungsnationalismus".
Rebell 2: Das Aquädukt.
Reg: Was?
Rebell 2: Das Aquädukt.
Reg: Oh. Jajaja. Das haben sie uns gegeben, das ist wahr.
Rebell 3: Und die sanitären Einrichtungen.
Loretta: Oh ja. Die sanitären Einrichtungen. Weißt Du noch, wie es früher in der Stadt stank?
Reg: Also gut ja, ich gebe zu, das Aquädukt und die sanitären Einrichtungen, das haben die Römer für uns getan.
Matthias: Und die schönen Straßen.
Reg: Ach ja, selbstverständlich die Straßen. Das mit den Straßen versteht sich ja von selbst, oder? Abgesehen von den sanitären Einrichtungen, dem Aquädukt und den Straßen...
Rebell 2: Medizinische Versorgung...
Rebell 5: Schulwesen...
Rebell 6: Die öffentlichen Bäder...
Loretta: Und jede Frau kann es wagen, nachts die Straße zu überqueren, Reg.
Francis: Jaha. Die können Ordnung schaffen, denn wie es hier vorher ausgesehen hat, davon wollen wir ja gar nicht reden.
VVJ: (zustimmendes Gemurmel)
Reg: Also gut. Mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und den allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?
Rebell 2: Den Frieden gebracht...
Reg: Aach! Frieden! Halt die Klappe.
Nein, ich rede nicht dem anderen alten Klischee, dem des "Zivilisationsbringers römisches Reich", das Wort. Den alten Hebräern mußten die Römer bestimmt keine zivilisatorische Errungenschaften bringen. Auch das, was Wilhelm Tacke neulich in der taz schrieb, ist schwerlich historisch haltbar:
Bonifatius - ein Europäer wo es unter anderem hießt:
Die ollen Germanen hatten sich mit jener berühmten Schlacht 9 nach Christus von Fortschritt und Zivilisation abgekapselt - für rund 500 Jahre.Die Griechen und Römer sahen sich in der antiken Welt als dieZivilisation, das ist wahr. Und sie hatten den Germanen (weniger den Kelten) einiges voraus. Allerdings zeigt gerade das Beispiel der Kelten, wie sich "zivilisatorisches Know How" auch ohne Eroberung oder Missionierung verbreiten konnte - übrigens ein Prozess, der in beiden Richtungen ablief. Die Germanen konnte da nicht mithalten, nicht weil sie tumbe Barbaren gewesen wären, sondern weil sie schlicht und einfach arm waren. Es fehlten ihnen einfach die Ressourcen, der Nachwelt prächtige Tempel und gute Straßen zu hinterlassen. Sie waren froh, wenn sie nicht verhungerten. Zivilisationsunfähig, wie es noch vor gar nicht so langer Zeit im "Spiegel" stand, waren sie nicht (siehe: Das Runen-Parodox).
Die Römer ware sicher nicht "besser" als die Barbarenvölker. Aber sie waren besser organisiert. Und sie waren erstaunlich tolerant und integrationsfähig. Als Rom 1000-jähriges Jubiliäum feierte, da saß der Sohn eines syrischen Scheichs auf dem Thron Philippus Arabs. Auch Arminus war römischer Offizier und römischer Bürger. In der "Varusschlacht" besiegte strenggenommen eine "römische" Armee eine andere römische Armee.
Und diese Integrationsfähigkeit, die Chance für jeden, römischer Bürger zu werden, die Fähigkeit, eine "multikulturelle", relativ offene, Gesellschaft zu bilden, machte die eigentliche Stärke des Imperiums aus. Als es unter Diocletian und Constantin (sehr zu unrecht "der Große" genannt) zu einem totalitären Obrigkeitsstaat umgemodelt wurde, wurde es scheinbar militärisch gestärkt, in Wirklichkeit aber seiner Stärken beraubt.
Die zivilisatorische Bilanz der meisten Imperien ist weniger gut als die des römischen Reiches, aber einige schneiden und schnitten auch wenn man Raubkriege und Ausbeutung berücksichtigt, erstaunlich gut ab, z. B. das "British Empire". Trotz Opiumkrieg und einiger Völkermorde.
Imperien gibt es in die Gegenwart: Russland hat eindeutig den Chrakter eines Imperiums, China mehr oder weniger auch, die USA eigentlich nicht - sie sind etwas weltgeschichtlich Neues. In mancher Hinsicht ist auch die EU ein "Imperium" - in anderer nicht, denn die Europäische Union ist polyzentrisch, sie hat im Unterschied zum klassischen Imperium mehrere "Führungsmächte".
Warum aber haben Imperien so einen schlechten Ruf, verglichen mit Nationalstaaten?
Wir haben uns daran gewöhnt, die Geschichte als evolutionären Prozeß vorzustellen, in dessen Verlauf der Nationalstaat das Imperium ablöst. Genau so, wie die Auflösung der großen Kolonialreiche in zahlreiche, willkürlich konstruierten "Nationalstaaten" mit höchst willkürlichen Grenzen als Fortschritt gesehen wurde.
Der Nationalstaat ist historisch recht jung, erste Nationalstaaten entwickelten sich im spätmittelalterlichen Europa, und zwar nicht "naturwüchsig", sondern indem sich ein Fürst und seine Gefolgschaft sich kraft seiner Hausmacht zunächst politisch und später kulturell gegen die Konkurrenz durchsetzte. Im "Heilligen Römischen Reich deutscher Nation" fehlte dieser Prozess fast völlig, es blieb ein locker zusammenhängernden Flickenteppich, weshalb der "verspäteten Nation" Deutschland stärker als anderen Nationen der "Konstruktcharakter" anzumerken ist: eine Nation, die buchstäblich gewaltsam zusammengeschmiedet wurde, und zu deren wichtigsten Klammer von Anfang an die Angst vor der (fast immer nur eingebildeten) äußeren Bedrohung gehörte.
Aber auch die Geschichte "besser konstruierter" Nationalstaaten ist mit wenigen Ausnahmen blutiger, brutaler, unterdrückerischer als die der großen Imperien. Intoleranz im Inneren und Aggression nach Außen sind die Hauptkennzeichen politischer Gebilde, die sich auf ethnischer "Homogenität" - gleiches "Blut", gleiche Kultur und vor allem gleiche Religion - gründen.
Wobei die "Homogenität" der Nationalstaaten stets Augenwischerei ist: kein Nationalstaat (wirklich keiner!) ohne "nationale Minderheiten". Weil sich fast alle Nationen auf eine Ideologie der "einheitlichen" oder zumindest "gemeinsamen" Sprache, Kultur, Religion und Geschichte, in besonders dummen Fälle auch auf "gemeinsames Blut" gründen, ist ein Nationalstaat tendenziell intolerant. Bis zum Völkermord. Das vielgepriesene "Selbstbestimmungsrecht der Völker" erwies sich oft, sehr oft, als Quelle von Unterdrückung, Vertreibungen, Grenzstreitigkeiten. Wobei das "Selbstbestimmungsrecht der Völker" ohnehin eine Fiktion ist - ein Volk ist ja kein Kollektivorganismus mit gemeinsamem Willen. Bestenfalls gibt es Mehrheitsentscheidungen innerhalb einer Bevölkerung.
Imperien haben eine bessere zivilisatorische Bilanz als Nationalstaaten. Die ideale Staatsform sind sie deshalb noch lange nicht. "Imperialismus" hat nicht zufällig einen schlechten Ruf. Neben den oben skizzierten "nationalistischen" Genoziden gibt es auch "imperialistische" Genozide. Und zwar immer dann, wenn die Einwohner eines zu erobernden Landes gleichgültig oder lästig waren.
Die Europäer brachten z. B. den Ureinwohnern Amerikas nicht "die Zivilisation" und waren auch nicht daran interessiert, sie als Bürger in ihre Kolonialimperien einzugliedern. Es ging schlicht um Land und Bodenschätze. Die Ureinwohner wurden in aller Regel nur als lästiger Störfaktor oder bestenfalls als Arbeitskräfte gesehen. Ähnlich lief die Kolonisation in den meisten Teilen Afrikas ab. (Ich vernachlässige hier absichtlich, dass die Kolonialimperien im Kern Nationalstaaten waren.)
Was ist also die zeitgemäße Staatform, in der sich Demokratie und pluralistische, offene Gesellschaft am besten entfalten können?
Es ist meiner Ansicht nach der postnationale Vielvölkerstaat. Ansatzweise sind die USA solch ein Staat, auch Indien könnte sich in diese Richtung entwickeln. Ich hoffe, dass die EU sich zu solch einem Staat weiterentwickelt. Aber am nähesten kommt diesem Ideal die Schweiz.
Diese Staatsform hat den Vorzug, dass kleine Volksgruppen in ihm keine geduldeten oder unterdrückten "nationalen Minderheiten" sind, sondern eben nur "kleine Volksgruppen".
Ein Spruch aus bioregionalistischen Kreisen ist: "Nur die Stämme werden überleben".
Ich setze dem entgegen: Stämme werden nur in postnationalen Vielvölkerstaaten überleben.
MMarheinecke - Donnerstag, 26. Oktober 2006