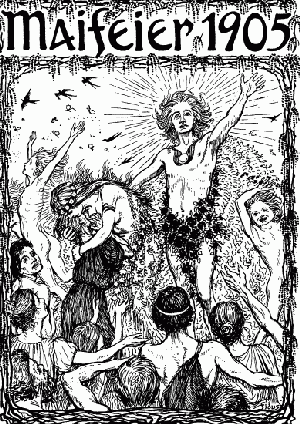Ich habe mich endlich aufgerafft. Zum Besuch der vieldiskutierten Ausstellung "Das schwarze Quadrat. Hommage an Malewitsch" in der
Hamburger Kunsthalle.
Das meistdiskutierte Stück der Ausstellung thront unübersehbar zwischen dem Altbau der Kunsthalle und dem steinernen hellen Würfel der Galerie der Gegenwart. Ein schwarzer Würfel, aus Tuch. Sehr passend als Hommage an Malewitschens Provokation, weil (ungewollt) provokativ.
Wobei: der einzige Grund, aus dem Gregor Schneiders 14 Meter hoher Würfel provokativ ist, ist das vorherrschende Gefühl und Motiv unserer "Mächtigen", unserer "Entscheider", in Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur - Angst. Angst vor Kontrollverlust: Alles, was nicht "beherrschbar" ist, ist bedrohlich. Und Angst, Angstmache, als Machttechnik: wer vor Angst nicht aus noch ein weiß, ist Beherrschbar.
Der Stoffwürfel entlarvte schon zweimal dieses "Lebensgefühl" des "Westens".
Eigentlich hätte Schneiders schwarzer Würfel als "Cube Venice" bereits zur Biennale in Venedig 2005 zu sehen sein sollen. Gregor Schneider erhielt eine Absage - weil der schwarze Kubus nicht nur ans schwarze Quadrat erinnert, sondern an die muslimische Kaaba in Mekka. Terrorgefahr!
Dann plante der "Hamburger Bahnhof" in Berlin die Installation des Kunstwerks - aber wieder eine Absage, aus Angst. Vorauseilender Kapitulation vor einem selbst an die Wand gemalten Teufel: denn für die Kaaba in Mekka den wichtigsten Wallfahrtsort der Muslime, besteht kein Abbildungsverbot. Wovon man sich, wenn man will, in jeder zweiten türkischen Teestube und jeden islamischen Zentrum mit eigenen Augen überzeugen kann.
Angst schafft eine eigene Realität. Es war eine groteske Mischung aus Unkenntnis, Paranoia und Medienspektakel - denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, und wozu eine gute Panik-Story mit einem Blick ins Lexikon "totrecherchieren" - die angesichts
halluzinierter befürchteter muslimischer Proteste zu dem vorauseilenden Kubus-Baustopp führte.
Anders in Hamburg. Vertreter der islamischen Gemeinden, die in Hamburg vor dem Bau des Kubus konsultiert wurden, hatten keinerlei Bedenken gegen ein Kunstwerk, das an die Kaaba erinnert: Ganz im Gegenteil! Man fühlt sich geehrt.
Und ganz im Sinne des Künstlers, denn Schneider selbst sieht seine Skulptur durchaus auch als eine Huldigung an das islamische Heiligtum und will damit für mehr interkulturelles Verständnis werben.
Mich selbst erinnert der schwarze Würfel an ein Gebilde, dass nur deshalb kein schwarzer Würfel war, weil selbst ein Stanley Kubrik Angst hatte, ein schwarzer Kubus könne als Abbild der Kaaba mißverstanden werden: der geheimnisvolle schwarze Monolith aus dem Film "2001 - Odysee im Weltraum". Wobei Kubrik nicht vor muslemischen, sondern christlich-evangelikalen Prostesten Angst hatte. Obwohl ich wußte, dass der Würfel nur ein stoffbespanntes Gestell ist, strahlt er (jedenfalls für mich) etwas unheimliches, außerweltliches, aus. Eine Projektionsfläche. Als ich den Kubus mit eigenen Augen sah, begriff ich, wieso es Menschen gibt, die vor ihm, vor dem, wofür er steht, Angst haben. Angst vor der Reflektion, Angst auch vor dem nicht sofort Erklärbaren, die sich dann nachträglich rationalisieren und z. B. auf den derzeitigen "Lieblingsfeind", den islamistischen Terror, projezieren.
Kaaba, Melewitsch Quadrat, der schwarze Monolilth aus "2001" und der Stoffwürfel sind - oder symbolisieren - Orte der Selbstverwandlung wie auch die spirituelle Dimension. Bei Malewitsch ist das keine Spekulation - "Ich aber verwandelte mich in die Nullform und kam jenseits der Null bei -1 heraus", schrieb Malewitsch in seinem Manifest 1915.
Und die Austellung? Sehenswert. Sie macht überzeugend deutlich, wieso ein harmloses (und im Grunde banales) "Schwarzes Quadrat auf weißem Grund" im frühen 20. Jahrhunderts in Europa und Amerika so provoziert und zur Auseinandersetzung angeregt hat.
Wie revolutionär seine Idee war, wird schon im Eingangsraum deutlich. Historiengemälde des 19. Jahrhunderts - keineswegs Kitsch, für sich genommen jedes durchaus sehenswert - in der damals üblichen "engen Hängung", in der sie die pompösen Gemälde sich gegenseitig erschlagen. Die Sackgasse, in der sich die etablierte Kultur in späten 19., frühern 20. Jahrhundert verrannt hatte.
Und als absoluter Kontrast: das in seiner Schlichtheit nicht zu überbietende "schwarze Quadrat". Tabula rasa. Neuanfang.
Gemälde, Installation, Skulpturen und Videofilme von fast 50 Künstlern gruppieren sich um das "schwarze Quadrat". Darunter (ich schreibe die Namen einfach mal ab) zahlreiche Werke von Malewitsch und seinen Zeitgenossen wie El Lissitzky oder Olga Rosanowa. Den großen Anteil an der Ausstellung haben Gegenwartskünstler: Richard Serras Stahlskulpturen, Carl Andres minimalistische Bodenarbeiten, Wandobjekte von Donald Judd oder Kompositionen von Imi Knoebel.
Alles Erben des "Schwarzen Quadrates". Jeder Werk für sich respektabel. Und doch drängt sich für mich jedenfall, der Eindruck auf, dass "die Moderne" auf ihre Weise ähnlich verrannt und erstarrt ist wie die akademische Kunst vor 100 Jahren. Irgendwie paßt die moderne Kunst gut zu Powerpoint-Präsentationen und Säulendiagrammen.
Die Rebellen sind tot. Es leben die ängstlich Angepassten. Ein Grund mehr, Kunsthallendirektor Hubertus Gaßner und dem Künstler Gregor Schneider Beifall zu zollen.
Freiheit wird aus Mut gemacht!